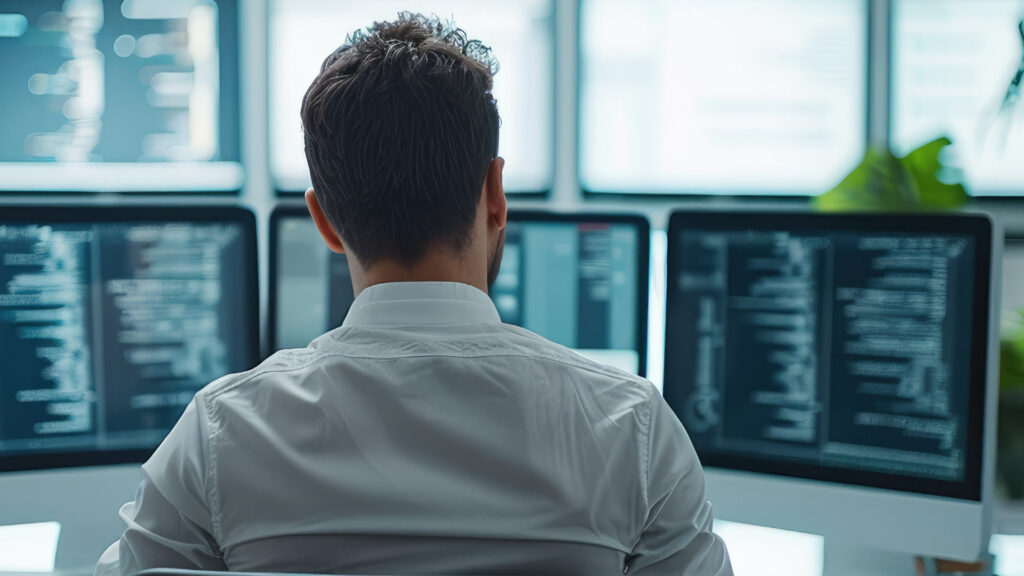Digital Resilience
Wie Unternehmen sich gegen Bedrohungen & Ausfälle wappnen und widerstandsfähig bleiben.
Digitale Resilienz: strategisches Vorausdenken für den Ernstfall
In einer zunehmend digitalisierten Welt ist die Fähigkeit eines Unternehmens, Sicherheitsrisiken zu erkennen, auf mögliche Vorfälle vorbereitet zu sein und sich rasch von erfolgten Angriffen zu erholen, ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Digitale Resilienz steht für die Gesamtheit der Strategien, Prozesse und Technologien, die Unternehmen einsetzen, um ihre IT-Infrastruktur vor Angriffen zu schützen, daraus zu lernen und im Falle eines Sicherheitsvorfalls schnell wieder handlungsfähig zu sein. Für IT-Entscheider ist das Verständnis dieses Konzepts essenziell, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Organisation nachhaltig zu stärken.
Dieses Wissensforum beleuchtet die zentralen Komponenten der digitalen Widerstandsfähigkeit mit Fokus auf Security Operations Center (SOC) sowie Notfallplanung und -Simulationen als Kernbestandteil von solider Cyber Resilience. Diese Themen sind Schlüsselbausteine, um eine robuste Sicherheitsarchitektur aufzubauen und um auf komplexe Bedrohungsszenarien effektiv zu reagieren.
Was ist digitale Resilienz? Definition und Bedeutung
Digitale Resilienz – auch als Digital Resilience respektive digitale Anpassungsfähigkeit bezeichnet –beschreibt zum einen die Fähigkeit von Organisationen, ihre IT-Infrastruktur, digitalen Systeme sowie technischen und organisatorischen Prozesse an veränderte Bedingungen anzupassen. Zum anderen beinhaltet sie die Kompetenz, auf Störungen – wie Cyberangriffe oder technische Ausfälle – effektiv zu reagieren, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Es geht also nicht nur um die Abwehr von Gefahren, sondern auch um die Fähigkeit, Ausfälle und Unterbrechungen zu bewältigen und den Betrieb schnell wieder aufzunehmen. Im Mittelpunkt der Maßnahmen stehen Prävention, Frühwarnsysteme, Reaktionsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung.
Kernkomponenten der digitalen Resilienz
Prävention: Sicherheitsmaßnahmen, um Angriffe zu verhindern.
Detektion: Früherkennung von Sicherheitsvorfällen.
Reaktion: schnelles Eingreifen bei Angriffen.
Wiederherstellung: Maßnahmen zur schnellen Rückführung in den Normalzustand.
Lernen: Analyse der Vorfälle, um die Sicherheitsstrategie zu optimieren.
All diese Schlüsselqualifikationen haben nicht nur eine technische, sondern auch eine organisatorische Seite. Das Unternehmen muss – im Rahmen eines Notfallplans – auf Cybervorfälle vorbereitet sein. Die Akteure müssen wissen, was zu tun ist: nicht nur die Geschäftsführung und die IT, sondern auch der Vertrieb, der Einkauf, die Entwicklung und die Produktion.
Angesichts zunehmender Bedrohungen wie Ransomware, Phishing, Zero-Day-Exploits und komplexen Angriffsszenarien ist eine starke Resilienz-Strategie unverzichtbar, um finanzielle Verluste, Reputationsschäden und regulatorische Konsequenzen zu vermeiden.
Die unterschiedlichen Aspekte von digitaler Resilienz
Technische Resilienz: die Fähigkeit der IT-Infrastruktur, Störungen zu widerstehen und sich schnell davon zu erholen. Dies beinhaltet Maßnahmen wie Backup-Systeme, Redundanz und Notfallpläne.
Organisatorische Resilienz: die Fähigkeit einer Organisation, ihre Prozesse und Abläufe an veränderte Bedingungen anzupassen und auf Störungen zu reagieren. Dazu gehören eine klare Teilung der Verantwortung, gut definierte Kommunikationswege und eine Kultur der digitalen Resilienz.
Individuelle Resilienz: die Fähigkeit von Mitarbeitern, mit digitalen Herausforderungen umzugehen und sich an neue Technologien anzupassen. Dies beinhaltet auch die Förderung von digitalen Kompetenzen und die Sensibilisierung für Risiken.
Ein wichtiger Aspekt der digitalen Resilienz ist die Vorbereitung auf den Ernstfall. Organisationen sollten, dem risikobasierten Ansatz folgend, eine umfangreiche Notfallplanung etablieren und demgemäß den Worst Case regelmäßig im Rahmen von Incident-Simulationen proben. Nur so lässt sich sicherzustellen, dass die Ernstfallprophylaxe valide ist und die beteiligten Personen wissen, was zu tun ist bzw. wie eine Security-Kultur verankert wird.
EU-weite Maßnahmen für eine bessere Cyber Resilience
Die Unternehmen und Einrichtungen sind in puncto Cybersicherheit leider noch nicht widerstandsfähig genug, daher hat die EU ein umfangreiches Bündel an Regularien erlassen. Beispiele sind NIS2, DORA oder der Cyber Resilience Act:
- Die EU-weite Network & Information Security-Richtlinie, Version 2 (NIS2) ist eine Überarbeitung der ursprünglichen NIS-Richtlinie, die 2016 verabschiedet wurde. Diese neue Direktive erweitert den Geltungsbereich und legt strengere Anforderungen an die Cybersicherheit fest. In Deutschland wird die Umsetzung des Verfahrens voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 starten.
- Der Digital Operational Resilience Act (DORA) ist eine EU-Verordnung, welche darauf abzielt, die digitale betriebliche Resilienz von Unternehmen im Finanzsektor zu stärken. DORA legt einen einheitlichen Rahmen für das Management von IT-Risiken fest und fordert von Finanzunternehmen, ihre Resilienz gegenüber Cyberangriffen und anderen Betriebsunterbrechungen zu erhöhen.
- Ab 2027 soll der Cyber Resilience Act (CRA) in der EU in Kraft treten. Mit dem CRA wird die Cybersicherheit von Produkten, die miteinander oder mit dem Internet verbunden werden, verbessert. Diese Produkte werden von Unternehmen hergestellt und an Endkunden vertrieben. Sie werden aber auch in Unternehmen für die Produktion eingesetzt sowie als Vorprodukte bezogen und weiter verbaut bzw. veredelt und sind damit Bestandteil von Lieferketten.
Security Operations Center (SOC): Herzstück der Sicherheitsüberwachung
Ein Security Operations Center (SOC) ist eine zentrale Einheit innerhalb eines Unternehmens, die für die Überwachung, Erkennung, Analyse und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle verantwortlich ist. Es fungiert im Rahmen einer übergreifenden Digital-Resilience-Strategie als das Frühwarnsystem der Organisation und nutzt moderne Technologien sowie qualifizierte Analysten, um Risiken in Echtzeit zu identifizieren.
Mit einem Security Operations Center kann die Abwehr von Gefahren aus dem Netz ganzheitlich und automatisiert gemanagt werden. Bedrohungen lassen sich besser erkennen und auch die aktive Gegenwehr sowie die Prävention verbessern sich, da alle Technologien und Prozesse im Bereich IT-Sicherheit in einem SOC vereinheitlicht und koordiniert werden.
Erfolgskriterien für ein Security Operations Center (SOC)
Was Sie in Sachen Cybercrime über die aktuelle Bedrohungslage und Regulatorik wissen sollten, wie ein effizientes Security Operations Center aufgebaut ist und in der Praxis funktioniert, welche Technologien und Prozesse für eine effektive Cybersicherheit entscheidend sind und wie der Weg zu einem modernen, abwehrstarken SOC aussieht: Das erleben Sie in diesem Webinar-Video.
Aufgaben eines SOC
- Überwachung aller IT-Systeme: kontinuierliche Analyse von Log-Daten, Netzwerkverkehr und Endpunkten.
- Erkennung von Bedrohungen: Einsatz von SIEM-Systemen (Security Information & Event Management), Intrusion Detection Systems (IDS) und anderen Tool-Sets.
- Analyse und Priorisierung: Bewertung der Bedrohungslage, um die kritischsten Vorfälle zu priorisieren.
- Reaktion und Eskalation: Koordination von Gegenmaßnahmen, Behebung von Schwachstellen und Eskalation an die Geschäftsleitung oder externe Partner.
- Berichterstattung und Dokumentation: Erstellung von Berichten für Compliance und Verbesserung der Sicherheitsstrategie.
Aufbau und Organisation eines SOC
Ein modernes SOC besteht aus spezialisierten Teams, die rund um die Uhr (24/7) arbeiten, um eine kontinuierliche Überwachung sicherzustellen. Es ist wichtig, klare Prozesse, Standards und Schnittstellen zu anderen Abteilungen wie IT-Infrastruktur, Incident Response und Management zu etablieren.
Technologien im SOC
- SIEM-Systeme: aggregieren und korrelieren Sicherheitsdaten.
- UEBA (User and Entity Behavior Analytics): Erkennung ungewöhnlicher Verhaltensmuster.
- Threat-Intelligence-Plattformen: Informationen über aktuelle Bedrohungen.
- Automatisierungstools: Unterstützung bei der schnellen Reaktion auf bekannte Bedrohungen.
Vorteile eines gut aufgestellten SOC
- Frühzeitige Bedrohungserkennung.
- Schnellstmögliche Reaktionszeiten durch einen hohen Automatisierungsgrad.
- Minimierung von Schäden durch Sicherheitsvorfälle.
- Verbesserung der Sicherheitslage durch kontinuierliche Lernprozesse.
- Erfassung aller wesentlichen Systeme, die im Unternehmen im Einsatz sind (IT und OT).
NextGen Cyber Defense mit der passenden SOC-Strategie
Wie Sie mit der richtigen NextGen Cyber-Defense-Strategie Ihre IT-Systeme und IT-Infrastruktur aktiv vor internen und externen Gefahren schützen, worauf es bei einem Security Operation Center (SOC) ankommt, welche SOC-Varianten es gibt und wie Sie mit der Bechtle Cyber-Defense-Center-Lösung Gefahren rasch erkennen und Sofort-Maßnahmen einleiten: Das lesen Sie in diesem Whitepaper.
Starke Alternative: das Managed Security Operations Center
Das permanente Monitoring eines Unternehmensnetzwerks ist die Hauptaufgabe eines SOC. Spezialisierte Dienstleister mit praxiserfahrenen Fachleuten können diese Aufgabe gemäß 24/7 Prinzip in Funktion eines Managed Security Operations Centers übernehmen – indem die Kunden die Überwachung ihrer Systeme ganz auslagern oder ihrem vorhandenen Team gezielte Unterstützung zuführen.
Advanced Persistent Threats (APTs): komplexe und langwierige Angriffe
Im Rahmen von optimierter digitaler Widerstandsfähigkeit, umfassender Notfallplanung und rascher Bewältigung der Folgen eines Cyberangriffs spielen Advanced Persistent Threats eine wichtige Rolle. Für Unternehmen und Organisationen ist es entscheidend, auf diese besonders perfide Ausprägung von Cyberkriminalität bestens vorbereitet zu sein.
Advanced Persistent Threats (APTs) sind gezielte, wohlüberlegte Angriffe, die von gut finanzierten und hochqualifizierten Akteuren (etwa staatlichen Akteuren oder kriminellen Organisationen) durchgeführt werden. Die Intention ist es, über einen längeren Zeitraum unbemerkt in der avisierten Umgebung zu verbleiben, um sensible Informationen zu stehlen, Einfluss zu nehmen oder Schaden anzurichten.
APTs stehen für zielgerichtete, aber auch hochkomplexe Cyberattacken auf kritische IT-Infrastrukturen von Unternehmen und staatlichen Institutionen. Bei einem APT-Angriff ist es die vorrangige Absicht der Hacker, vertrauliche Daten zum Zweck der Spionage oder Sabotage zu stehlen.
Merkmale von APTs
- Gezielt: fokussiert auf bestimmte Organisationen, Branchen oder Systeme.
- Hochentwickelt: Einsatz moderner Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs).
- Geduldig: verfolgen langfristige Strategien und bleiben oft monatelang unentdeckt.
- Mehrstufig: umfassen Phasen wie Reconnaissance, Initial Access, Privilege Escalation, Lateral Movement, Data Exfiltration und Persistenz.
Phasen eines APT-Angriffs
- Reconnaissance: Sammeln von Informationen über das Ziel.
- Initial Access: Eintritt in das Netzwerk, z.B. durch Phishing, Exploits oder Lieferkettenangriffe.
- Establish Foothold: Aufbau dauerhafter Zugänge.
- Lateral Movement: Ausbreitung innerhalb der Infrastruktur.
- Data Exfiltration: Abfluss sensibler Daten.
- Maintaining Persistence: Sicherstellung des Zugriffs auch nach Gegenmaßnahmen.
Bekannte APT-Gruppen
Beispiele sind APT28 (Fancy Bear), APT29 (Cozy Bear), Lazarus Group und andere, die mit verschiedenen Ländern und Zielen assoziiert werden.
Gängige Schutzmaßnahmen gegen APTs
- Starke Zugangskontrollen und Multi-Faktor-Authentifizierung.
- Netzwerksegmentierung.
- Kontinuierliches Monitoring mittels SOC.
- Einsatz von Endpoint Detection & Response (EDR)-Lösungen.
- Mitarbeiterschulungen gegen Social Engineering.
- Regelmäßige Sicherheitstests und Penetrationstests.
- Nutzung von Threat Intelligence zur Frühwarnung.
APT-Response: Strategien und Maßnahmen
APT-Response umfasst alle Maßnahmen, um einen laufenden oder erfolgten APT-Angriff zu erkennen, einzudämmen, zu analysieren und nachhaltig zu beseitigen. Da APTs häufig lange unentdeckt bleiben, ist eine proaktive und koordinierte Reaktion essenziell
Schritte im APT-Response-Prozess
- Erkennung: Einsatz von Security Information & Event Management (SIEM), Endpoint Detection & Response (EDR), Threat Intelligence und Verhaltensanalysen, um Anzeichen für einen APT-Angriff zu identifizieren.
- Eindämmung: Sofortmaßnahmen, um die Ausbreitung des Angriffs zu stoppen, etwa Isolierung infizierter Systeme.
- Analyse: forensische Untersuchungen, um den Angriffsvektor, die Angreifer und das Ausmaß zu bestimmen.
- Beseitigung: Entfernung von Schad-Software, Schließung von Schwachstellen, Patch-Management.
- Wiederherstellung: Wiederherstellung der Systeme, Data Recovery aus Backups.
- Kommunikation: interne und externe Kommunikation, z.B. gegenüber Behörden, Kunden und Partnern.
- Lernen: Nachbereitung, um Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und zukünftige Angriffe zu erschweren.
Best Practices im APT-Response
- Incident Response Team (IRT): speziell geschultes Team, das im Ernstfall schnell und effektiv handeln kann.
- Playbooks: vorgefertigte Reaktionspläne für verschiedene Szenarien.
- Automatisierung: Nutzung von SOAR (Security Orchestration, Automation & Response) zur Beschleunigung der Reaktionsprozesse.
- Threat Hunting: proaktive Suche nach versteckten Angreifern und Hintertüren.
- Zusammenarbeit: Austausch mit Threat Intelligence-Anbietern, Behörden und anderen Unternehmen.
Wichtige Tools für die APT-Response
- Security Information & Event Management (SIEM) & Endpoint Detection & Response (EDR): Überwachung und Echtzeitanalyse.
- Forensik-Tools: Analyse von Malware, Log-Daten und Netzwerkverkehr.
- Threat-Intelligence-Plattformen (TTPs): aktuelle Informationen über bekannte APT-Gruppen und TTPs.
- Automatisierungstools: Unterstützung bei der schnellen Reaktion.
Unterstützung durch qualifizierte APT-Response-Dienstleister
Bei Advanced Persistent Threats ist spezielles und vor allem rasch abrufbares Know-how besonders gefragt. Empfehlenswerte Partner sind vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als qualifizierte APT-Response-Dienstleister im Sinne von § 3 BSIG zertifiziert und unterstützen vor allem Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) bei der Abwehr und der Bewältigung groß angelegter Cyberangriffe.
Erste Hilfe zur richtigen Zeit – wenn es darauf ankommt
Wenn es zu einem Angriff kommt, muss schnell reagiert werden. Sollte die Unternehmens-IT infolge einer Attacke handlungsunfähig sein, ist rascher Support von versierten Experten vonnöten. Sofern Daten von Cyberkriminellen verschlüsselt wurden, bietet ein erfahrenes Incident-Response- & Forensik-Team professionelle Unterstützung bei der gerichtsverwertbaren Spurensicherung und achtet gleichzeitig auf eine lückenlose Beweiskette. Das ist besonders dann wichtig, wenn Unternehmen nach einem Vorfall gesetzlich dazu verpflichtet sind, Strafanzeige zu stellen. Übrigens: Das betrifft alle Unternehmen, die als Betreiber Kritischer Infrastrukturen unter die KRITIS-Regelungen fallen.
Security Operations Center (SOC) mit Outsourcing-Prinzip
Der Mangel an Cybersecurity-Experten und hohe Kosten machen den Eigenbetrieb eines in Zeiten von grassierender Cyberkriminalität substanziell notwendigen Security Operations Centers (SOC) für viele Unternehmen unwirtschaftlich. Das Outsourcing an einen spezialisierten SOC-Dienstleister bietet hier eine sinnvolle und strategisch kluge Alternative.
Integration von SOC und APT-Response in die digitale Resilienz-Strategie
Ein gut funktionierendes SOC bildet das Rückgrat der APT-Erkennung und -Reaktion. Durch kontinuierliches Monitoring, Analyse und Automatisierung kann ein SOC frühzeitig Anzeichen eines APT erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten.
Aufbau einer resilienten Sicherheitsarchitektur
- Layered Security: Mehrschichtige Verteidigungssysteme, die Angreifer auf verschiedenen Ebenen abwehren.
- Automatisierte Reaktionsmaßnahmen: Einsatz von Security Orchestration, Automation & Response (SOAR), um Reaktionszeiten zu minimieren.
- Kulturelle Sicherheitskultur: Sensibilisierung der Mitarbeitenden und klare Prozesse.
- Regelmäßige Tests und Übungen: Simulationen von Angriffsszenarien zur Überprüfung der Reaktionsfähigkeit.
Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich ständig weiter. Daher ist es notwendig, die Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig zu überprüfen, Threat Intelligence zu integrieren und die Fähigkeiten des SOC sowie des Incident-Response-Teams zu erweitern.
Die Bedeutung der digitalen Resilienz für Unternehmen
In einer Welt, in der Cyberangriffe zunehmend komplex, gezielt und erfolgreich sind, ist der Aufbau und die Pflege digitaler Resilienz keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Ein funktionierendes SOC sowie eine effektive APT-Response-Lösung sind essenzielle Bestandteile dieser Strategie. Sie ermöglichen es Unternehmen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, effizient darauf zu reagieren und die Auswirkungen zu minimieren.
Die Investition in moderne Technologien, qualifizierte Teams, kontinuierliche Weiterbildung sowie kompetente Dienstleister und Partner zahlt sich aus, weil sie die Widerstandsfähigkeit gegenüber immer raffinierter werdenden Angriffen stärkt. Letztendlich geht es darum, die Geschäftsprozesse und die Reputation nachhaltig zu schützen und das Vertrauen der Kunden zu sichern.
Das Bechtle Cyber Defense Center (CDC) integriert Cisco XDR
Das Bechtle Cyber Defense Center (CDC) geht weit über klassische Security Operations Center (SOC)-Lösungen hinaus, indem es Security Information & Event Management (SIEM), Endpoint Detection & Response (EDR), Network Detection & Response (NDR) sowie eine automatisierte Security Orchestration, Automation & Response (SOAR)-Plattform kombiniert. Alle relevanten Lösungsansätze und Hersteller am Markt werden unterstützt. Ganz neu und mit besonderem Fokus: die Integration der Cisco XDR Technologien.